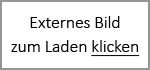Hallo,
muss nächste Woche ein Referat über Motoraufladung halten,
also Kompressor,Turbo, Druckwellenaufladung G Lader usw.
Zum Großteil hab ich eigentlich schon brauchbare Infos, nur zum G-Lader fehlt mir irgendwie ein gutes Symbolbild.
Hab schon auf div. G-Lader Info Seiten geschaut aber irgendwie wird nirgends deutlich gezeigt, wie die exzentrische Welle in der Mitte arbeitet.
Hat da jemand etwas für mich ? ? (eventuell auch ein fertiges Referat? *gg*)
muss nächste Woche ein Referat über Motoraufladung halten,
also Kompressor,Turbo, Druckwellenaufladung G Lader usw.
Zum Großteil hab ich eigentlich schon brauchbare Infos, nur zum G-Lader fehlt mir irgendwie ein gutes Symbolbild.
Hab schon auf div. G-Lader Info Seiten geschaut aber irgendwie wird nirgends deutlich gezeigt, wie die exzentrische Welle in der Mitte arbeitet.
Hat da jemand etwas für mich ? ? (eventuell auch ein fertiges Referat? *gg*)
Nur wer verschiedene Blickwinkel in betracht zieht und überdenkt, hebt sich von den einfach-denkenden Menschen ab!